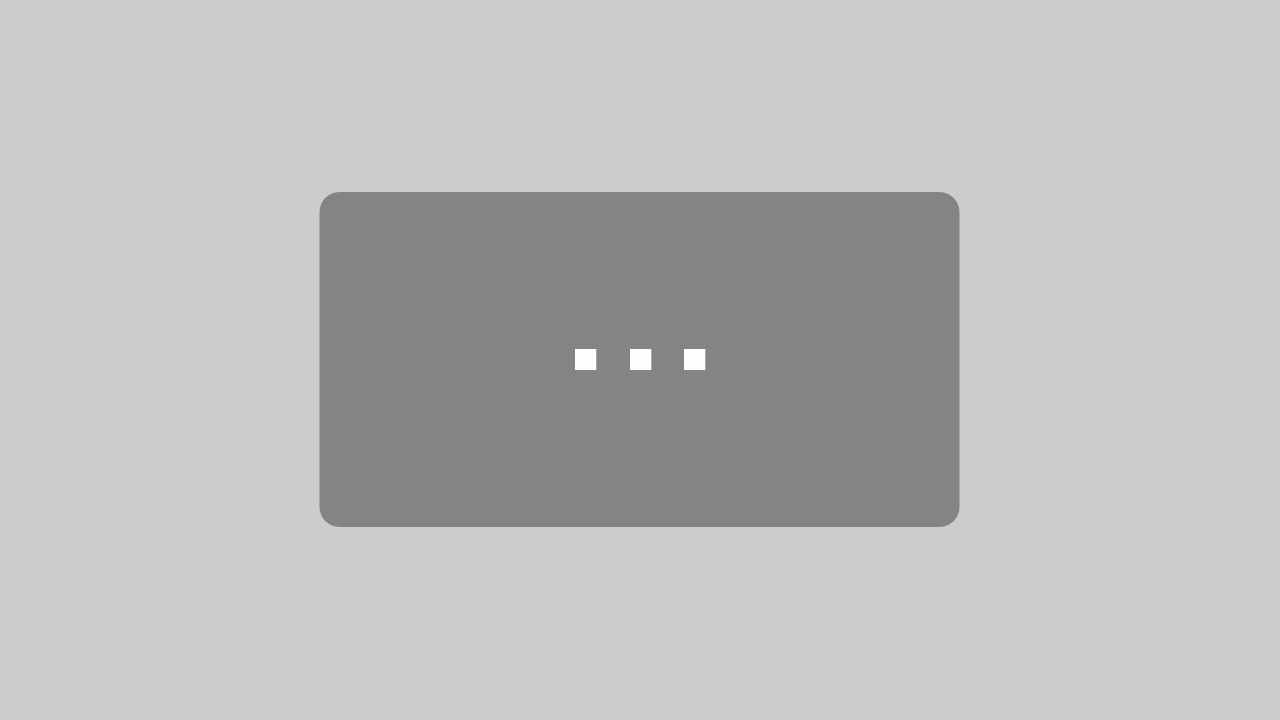Es scheint sich wohl eingebürgert zu haben, daß Netflix so um die Herbst-Winterzeit eine Serie abseits des Thriller-, Spionage-, Action- und SF-Genres platziert, die authentisch und realistisch daherkommt, auch wenn es sich in Wahrheit um die Pseudoversion dieser Adjektive handelt. Macht aber nichts, wenn das Publikum das Gesehene als Wie-im-richtigen-Leben wahrnimmt und sich an der Story erfreut, warum nicht?
Im letzten Jahr waren es „Das Damengambit“ mit der unvergleichlichen Anya Taylor-Joy und die türkische Mini-Serie „Bir Başkadır – Acht Menschen in Istanbul“ mit der nicht weniger talentierten und hübschen Öykü Karayel in den Hauptrollen.
Auffällig ist, daß es sich bei solcherart Serien immer um das harte Schicksal von jungen Frauen dreht, die gegen alle (männlichen) Widerstände am Ende ihren Platz an der Sonne finden, daß überhaupt das Feminine, auch was das numerische Geschlechterverhältnis der Rollencharaktere anbelangt, dominiert.
Und hier sollte man innehalten und erkennen, daß der Slogan „Sex sells“ immer noch das beste Verkaufsargument ist, auch wenn in unserer irre politisch korrekten Zeit die Sache mit der „geilen Schnitte“ uns quasi chiffriert und in der Verkleidung unbeugsamer und kämpferischer Fraulichkeit präsentiert wird. Das Problem ist eben, daß die „sympathische Hauptfigur“ uns umso sympathischer erscheint, je weniger sie einer häßlichen Schabracke ähnelt, und je mehr wir uns in ihr garstiges Schicksal hineinfühlen können, wenn sie trotz der Kostümierung als prekäres Mäuschen unterschwellig geballte Sexiness ausstrahlt. Da hat sich seit Menschengedenken nichts geändert. Doch dazu später.
„Maid“ ist zur Zeit der Überraschungshit auf Netflix, eine Mini-Serie, die an die Mega-Erfolge ihrer oben genannten Vorgängerinnen locker anknüpfen könnte und wird. Sie basiert auf dem Roman „Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive“ von Stephanie Land.
In der Story geht es um eine alleinerziehende junge Mutter namens Alex, die sich aus einer „toxischen“ Beziehung mit ihrem Ex-Freud befreien konnte. Nun wagt sie mit ihrer Tochter Maddy einen Neustart, aber ihr Vorhaben erweist sich als äußerst schwierig. Alex hat kaum Geld und muß einen Job als Putzkraft annehmen, bei dem sie riesige Villen von reichen Menschen reinigt. Während die junge Mutter versucht, ihr Leben irgendwie in den Griff zu bekommen, holt ihre Vergangenheit sie aber immer wieder ein, doch Alex läßt sich davon nicht unterkriegen.
Das Ganze ist so etwas wie das in die Länge gezogene „The Pursuit of Happyness“ (Das Streben nach Glück / USA 2006 / Regie: Gabriele Muccino) mit Will Smith in der Hauptrolle, inklusive Obdachlosigkeit mit Kind, gelegentlichem Kontakt zu Reichen, die bass erstaunt darüber sind, wie man überhaupt so arm sein kann, hammerharten Tiefschlägen und dem nicht totzukriegenden Willen der Hauptfigur, auf einen grünen Zweig zu kommen.
Und ebenso wie in „The Pursuit of Happyness“ beruht der finale Erfolg nicht darauf, daß der/die Held/in schlußendlich einen 08/15-Job bekommt, der einen so halbwegs über Wasser halten kann, nein, das Licht am Ende des Tunnels verheißt einen größeren Sprung nach oben. Die Will-Smith-Figur wird ein supererfolgreicher Börsenmakler, Alex winkt eine aussichtsreiche Schriftstellerkarriere. Wer hätte das gedacht?
Die halbe Miete für den Reiz der Serie liefert der momentane Shootingstar Hollywoods Margaret Qualley, die Alex spielt.

Sie ist das dritte und jüngste Kind der Schauspielerin Andie MacDowell aus deren erster Ehe mit Paul Qualley. Lustigerweise spielt ihre Mutter auch die Film-Mutter in der Serie.
Qualley, eine mädchen- und elfenhafte und über Maßen schöne junge Frau, ist nicht gerade die Begnadetste im Schauspielfach. Aber sie hat das gewisse Etwas, wirkt immer sehr verletzlich und stellt durch ihr natürliches Auftreten, mit ihrem Schmollmund und ihrem Schlabberlook eine Projektionsfläche für das junge weibliche Publikum dar. Außerdem kann nicht jede Schauspielerin eine Meryl Streep sein.
Die Frage ist jedoch durchaus berechtigt, was solch eine prinzessinnenhafte Gestalt in einem White-Trash-Tableau des Ganz-unten-Amerikas zu suchen hat, wo der Trailer Park die natürliche Wohnumgebung ist und Männer immer so aussehen, als wuschen sie sich nur zu besonderen Anlässen.
Doch bevor die Kritik kommt, sprechen wir über das Gelungene und Positive an „Maid“.
Ganz wichtig: Machen die einzelnen Folgen süchtig, will man immer weitergucken?
Eindeutig ja!

Man kann sich einfach nicht dem perversen Reiz entziehen, mitzuverfolgen, wie Alex Stufe um Stufe immer tiefer fällt, ist schockiert, daß von ganz unten offenbar noch eine weitere Stufe tiefer geht, und ist doch überrascht und erleichtert darüber, wie diese zarte Frau sich jeder dieser Krisen mit eisernem Durchhaltewillen und harter Arbeit entwindet, nicht aufgibt und sich Ziel um Ziel immer wieder freischwimmt.
Besonders gelungen ist auch das Setting und die Kameraarbeit, die diese Kontrastwelten zwischen postmodernen Protzvillen, der Wohnwagentristesse, der Verlorenheit in den Frauenhäusern, aber bisweilen auch herzerwärmende Naturbilder perfekt einfangen. Die Armut, das prekäre Leben, die Scheiß-Jobs für ein paar lumpige Dollar, die immerwährende Verzweiflung derer, die nicht das Glück hatten, vom Kuchen des American Dream ein Stück abzubeißen, sind optisch greifbar.
Zudem räumt die Story mit dem Klischee auf, daß es sich bei den USA um ein raubtierkapitalistisches Land handelt, das Wohlfahrt in unserem Sinne nicht kennt. Es kennt sie nur anders und monströs bürokratischer als bei uns.
Das Darstellerensemble ist ganz ordentlich, aus dem Nick Robinson als Alex´ Proll-Freund Sean grandios herausragt und dem ich hiermit eine rasante Hollywood-Karriere voraussage.

Und man bekommt einen Stich ins Herz, die Schönste aller Schönen unserer 80er und 90er Jahre, die Traumfrau Andie MacDowell als nervige, vertrocknete Schreckschraube mit bipolarem Knall als Alex´ Mutter Paula zu sehen.
Aber genug gelobt. Was läuft schief bei „Maid“? So einiges.
Zunächst einmal ist die Serie bis in die Kiemen politisch korrekt. Die reiche Frau, eine Anwältin, deren Villa Alex putzt und die zunächst ein typisches überhebliches Reichengehabe an den Tag legt, ihr aber am Schluß juristische Unterstützung leistet, ist natürlich keine Weiße, sondern eine Schwarze. Etwas heller sind ihre Arbeitgeberinnen, die sie für einen Hungerlohn schuften lassen. Auch die anderen Frauen – Männer tauchen in der Story eigentlich nur als Fremdkörper auf – scheinen nach den People-of-Color-Richtlinien gecastet worden zu sein. Alex hat keine weiße Freundin, obwohl sie aus einem Hillbilly-Umfeld kommt.
Das tut der Geschichte keinen Abbruch, viel penetranter ist da die fast minütlich beschworene Frauensolidarität, die einem mit der Zeit auf den Geist geht und das weibliche Geschlecht dadurch entwertet, daß sie alle Frauen zu Mutterkühen im Herzen macht.
In „Maid“ bricht der Konflikt vorausschaubar durch „toxische Männlichkeit“ aus. Bloß kriegen wir davon nix mit.
Alex trennt sich von Sean und geht ins Frauenhaus, weil er sie aggressiv angegangen haben soll. Und wie sieht das aus? Er hat sie angeschrien und ein Fenster eingeschlagen, nicht einmal geschlagen hat er sie.
Großer Gott, was erwartet die Frau von solch einem Berufsproll, einem geborenen Loser, der zwischen Billig-Jobs, Alkohol-Abstürzen, bußfertigen Entzugstherapien und völlig irrationalen Entscheidungen hangelt? Dabei ist die Figur von Sean die facettenreichste, die Nick Robinson mit fettigen halblangen Haaren, schmerzdurchdrungener Miene und stets unterdrückter Aggressivität erstklassig darstellt. Der Junge bemüht sich ja, ein besserer Mensch zu werden, auch wenn er sich dabei immer wieder selbst ein Bein stellt. Unter „toxischer Männlichkeit“ verstehe ich etwas Schlimmeres.
Dann kommt Alex´ Schulfreund Nate (Raymond Ablack) ins Spiel. Er ist ein erfolgreicher, gutaussehender Ingenieur, besitzt ein wunderschönes großes Haus, ist die Zuvorkommenheit in Person und läßt Alex und ihre Tochter eine Zeitlang bei sich wohnen. Er tut überhaupt alles, um sie für sich zu gewinnen. Natürlich will er sie ficken.
Aber auch hier Fehlanzeige, was dieses toxische Dingens angeht. Er schleicht sich nicht in der Nacht in ihr Zimmer, um sie zu vergewaltigen, er setzt sie nicht mit irgendwelchen Anspielungen unter Druck, daß sie für ihren Aufenthalt letzten Endes „bezahlen“ müsse, spielt liebevoll den Ersatzvater für ihre Tochter, hält überhaupt alle Regeln des Anstands und des korrekten Werbens um eine Frau strikt ein.
Auch Alex ist von ihm derart angetan, daß sie ihn in ihrer Wunschvorstellung als Cowboy mit muskulösem nacktem Oberkörper sieht. Nate ist also durchaus ihr Typ.
Aber was macht die dumme Nuß als Dank? In einem merkwürdigen Verzweiflungsanfall schläft sie wieder mit ihrem Ex Sean. Na toll!
Diese Szene, ach was, diese eine Einstellung, in der er ihr die Hose runterzieht, ist auch die einzige in den 9 Folgen, in der so etwas wie Sex angedeutet wird. Und jetzt kommt der Knaller: Um der Political Correctness Genüge zu tun, muß dieser arme Hillbilly nach Drehbuch auch noch erst fragen, ob sie damit wirklich einverstanden ist. Nachdem sie Ja gesagt hat, kommt der Schnitt.
Nate schmeißt sie daraufhin natürlich raus, aber nicht ohne ihr vorher ein Auto geschenkt zu haben! Ich hätte es an seiner Stelle viel früher getan und geschenkt hätte ich ihr einen feuchten Handschlag.
Es ist diese Feigheit vor irgendwelchen Tweet-Shitstorms und feministischem Geraune, dramaturgisch nicht bis zum Äußersten zu gehen und knallharte Dinge nicht explizit und knallhart zu zeigen, was die Serie schwächt. Wenn Alex´ Welt so sehr von bösen Männern dominiert und verwüstet wird, dann will ich es auch sehen, verdammt nochmal!
Es sind diese schablonenhaften Behauptungen, ohne daß sie filmisch bewiesen werden, diese Konflikte, die sich immer nur durch Zufall auflösen oder indem der Konfliktauslöser sich wieder auf seine menschlichen Tugenden besinnt, diese unlogischen Figuren, die irgendwie alle herzensgut sind, aber um die Spannung aufrechtzuhalten zwischendurch das Arschloch markieren müssen, dieses nichts Halbes und nichts Ganzes ist es, was „Maid“ storytechnisch und filmisch nicht über sich hinauswachsen läßt.
Das Ende ist eine einzige Kitschkatastrophe und hätte auch aus einem Filmmusical der 50er stammen können.
Aber nochmal, das Ding ist nicht wirklich schlecht, ein angenehmer und lohnender Zeitvertreib, eine interessante Seite aus dem Album der Lebenswelten und zeigt eine atemberaubend schöne junge Frau, die selbst im verdreckten Putzkittel zum Anbeißen aussieht (noch geiler kommt die süße Margaret übrigens in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ als Hippie-Mädchen rüber).
Okay, vielleicht ist „Maid“ auch das, was man einen Frauenfilm nennt, und Frauen mögen es halt nicht so extrem. Da muß man, was dieses Genre heutzutage angeht, geradezu dankbar sein, daß Alex am Ende nicht lesbisch wird.

MAID, Netflix, 2021
Update
Daß Margaret Qualley nicht so doll spielen kann, nehme ich zurück. Sie kann es! Hier ist der Beweis: